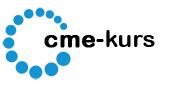Einleitung
Der Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) wird immer mehr zu einer internationalen Veranstaltung, dessen Bedeutung weit über die europäischen Grenzen hinausreicht. Über 33.000 aktive Teilnehmer und mehr als 190 simultane Publikationen aus den verschiedenen Themenbereichen in hochrangigen Journalen sprechen für sich und unterstreichen die zentrale gesellschaftliche Bedeutung der Herzmedizin von der Prävention bis zur Intervention und zu innovativen pharmakologischen Therapiestrategien. Die Ergebnisse der klinischen Studien finden im Anschluss an eine wissenschaftliche Diskussion rasch Eingang in die entsprechenden Therapieleitlinien, deren Update-Frequenz sich zunehmend beschleunigt. In dieser Fortbildung werden ausgewählte klinische Studien aus den Hotline-Sessions und wichtige Leitlinien-Updates vorgestellt und diskutiert, die auf dem aktuellen ESC-Kongress in Madrid präsentiert wurden.
VICTORIA-Studie: Vericiguat bei HFrEF-Patienten mit hohem Dekompensationsrisiko
In dieser doppelblinden placebokontrollierten Studie wurde untersucht, ob Vericiguat zusätzlich zur Basistherapie bei insgesamt 6105 ambulanten Patienten mit einer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) die Zeit bis zur Herzinsuffizienz-bedingten Hospitalisierung (HFH) oder bis zum kardiovaskulär bedingten Tod (primärer kombinierter Endpunkt) verlängert. Die Randomisierung erfolgte im Verhältnis 1 : 1 auf Vericiguat oder Placebo. Vericiguat aktiviert die lösliche Guanylatzyklase, wodurch die intrazelluläre NO-Konzentration (Stickstoffmonoxid) wieder ansteigt. Dadurch hat Vericiguat das Potenzial, die pathophysiologischen Mechanismen bei der Herzinsuffizienz günstig zu beeinflussen. Durch die endotheliale Dysfunktion wird NO nicht in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt. Dadurch kommt es zu einer unzureichenden Aktivierung der Guanylatzyklase und damit zu einer Reihe von pathologischen Veränderungen wie der Versteifung und Verdickung des Herzmuskels, zum Remodeling und zur Arterienverengung. Die Wirksamkeit von Vericiguat wurde in der VICTORIA-Studie bei fortgeschrittenen HFrEF-Patienten dokumentiert, die entweder innerhalb von sechs Monaten vor Studienbeginn wegen einer kardialen Dekompensation hospitalisiert waren oder innerhalb von drei Monaten vor Studienbeginn eine intravenöse Diuretikatherapie benötigten. Diese sogenannten „Drehtürpatienten” haben ein besonders hohes Dekompensationsrisiko und profitierten in der VICTORIA-Studie insbesondere dann, wenn die N-terminales pro Brain natriuretisches Peptid-(NT-proBNP-)Spiegel bei den Patienten unter 8000 pg/ml lag.
VICTOR-Studie: Vericiguat bei HFrEF-Patienten mit geringerem Dekompensationsrisiko
Für die VICTOR-Studie wurden Patienten mit einer stabilen reduzierten Pumpfunktion (linksventrikuläre Ejektionsfraktion, LVEF ≤40 %) unter leitlinienbasierter Basismedikation (GDMT) rekrutiert, die im Zeitraum sechs Monate vor Studienbeginn keine HFH hatten oder drei Monate vorher keine ambulante intravenöse Diuretikatherapie benötigten. Diese ambulant geführten Patienten hatten also mit Blick auf ihre Herzinsuffizienz ein geringeres Dekompensationsrisiko. 83,4 % der Patienten waren mit mindestens drei der in den Leitlinien empfohlenen Basismedikamenten versorgt. 47 % der Patienten waren wegen ihrer Herzinsuffizienz noch nie in einer Klinik, und bei 14,1 % lag die letzte Herzinsuffizienz-bedingte Hospitalisierung im Zeitraum zwischen zwölf und sechs Monaten vor Therapiebeginn. Der primäre kombinierte Endpunkt wurde nach einem medianen Follow-up von 18,5 Monaten nicht reduziert [HR = 0.93 (95%-KI 0.83–1.04); p = 0.22]. Nach zwölf Monaten erhielten 84,9 % der Patienten in der Vericiguat-Gruppe die Zieldosis von 10 mg einmal täglich. Das Sicherheitsprofil war mit Placebo vergleichbar. Die Studie war gepowert, um zu testen, ob Vericiguat das Risiko eines kardiovaskulären Todes als wichtigen sekundären Endpunkt senken kann. Die Nachbeobachtung wurde deshalb fortgesetzt, bis die notwendige Anzahl von 590 kardiovaskulären Todesfällen erreicht war. Das neutrale Ergebnis des primären Endpunktes schränkt aber per definitionem die Aussagekraft aller Subgruppenanalysen ein. Vericiguat konnte die Zeit bis zum kardiovaskulären Tod verlängern [HR = 0.83 (95%-KI 0.71–0.97); p = 0.02] und zeigte bei der Auswertung der Gesamtmortalität als explorativem Endpunkt einen Überlebensvorteil von 16 % gegenüber Placebo. Dieser Überlebensvorteil war unabhängig von der Hintergrundtherapie. Eine weitere Subgruppenanalyse zeigte, dass der klinische Nutzen von Vericiguat tendenziell umso besser war, je kürzer der Zeitraum der letzten Herzinsuffizienz-bedingten Hospitalisierung vor Studienbeginn war. Das passt zum positiven Ergebnis der VICTORIA-Studie bei Hochrisikopatienten.
Gepoolte Analyse der VICTORIA- und VICTOR-Studie
Diese vorab festgelegte Analyse mit insgesamt 11.155 Patienten wurde durchgeführt, um die Auswirkungen von Vericiguat auf die klinischen Ergebnisse bei einer breiten Patientengruppe mit unterschiedlichem HFrEF-Schweregrad und unterschiedlichem klinischen Risiko zu bewerten. Vericiguat verbesserte die klinischen Ergebnisse mit Blick auf den primären kombinierten Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod oder der ersten Herzinsuffizienz-bedingten Hospitalisierung (HFH) über das gesamte Risikospektrum im Vergleich zu Placebo [HR = 0.91 (95%-KI 0.85-0.98); p = 0.009]. Die Patienten, die nicht vorher wegen ihrer Herzinsuffizienz hospitalisiert waren oder bei denen keine vorherige intravenöse Diuretikatherapie notwendig wurde, profitieren nicht von Vericiguat. Vericiguat ist also erst bei HFrEF-Patienten nach der ersten Hospitalisierung indiziert, hat einen relativ großen Spielraum bei Patienten mit einer eingeschränkten Nierenfunktion und nur einen geringen Effekt auf den Blutdruck, der bei der Behandlung von Patienten mit einer HFrEF häufig ein limitierender Faktor ist.
DIGIT-HF Studie: Digitoxin zusätzlich zur Standardtherapie bei HFrEF
Die Geschichte der Digitalisglykoside Digitoxin und Digoxin zur Behandlung von Herzerkrankungen reicht bis in das Mittelalter zurück. Isoliert wurden die Substanzen erstmals vor nahezu 100 Jahren und wurden mit der Einführung der ACE-Hemmer zunehmend als Therapiestandard zur Behandlung der HFrEF abgelöst. Heute wird ihr Stellenwert bei der Herzinsuffizienz auch aufgrund der geringen therapeutischen Breite kontrovers diskutiert. In der unabhängig durchgeführten kontrollierten DIGIT-HF Studie wurden 1212 Patienten mit einer sehr pragmatisch definierten symptomatischen HFrEF (New York Heart Association, NYHA II-IV, LVEF ≤40 %) zusätzlich zur leitlinienbasierten Basistherapie randomisiert im Verhältnis 1 : 1 entweder mit Digitoxin oder Placebo behandelt. Als primäres Zielkriterium wurde Tod jeglicher Ursache oder Herzinsuffizienz-bedingte Hospitalisierung festgelegt. Die Studie begann vor etwa zehn Jahren, was entsprechende Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Basistherapie hatte. Digitoxin verbesserte das primäre Outcome mit einer absoluten Risikoreduktion von 4,6 % und einer NNT (Number needed to treat) von 22 [HR = 0.82 (95%-KI 0.69–0.98); p = 0.03]. Digitoxin ist somit eine weitere Option für die Behandlung von Patienten mit einer HFrEF, wobei allerdings regionale Engpässe bei der Verfügbarkeit der bei Bedarf reduzierbaren Studiendosis von 0,07 mg zu berücksichtigen sind.
POTCAST-Studie: Hochnormales Serumkalium verbessert Outcome bei ICD-Patienten
Der Einfluss von Kalium auf den Blutdruck und auf Herzrhythmusstörungen ist gut bekannt. Die Risikokurve verläuft abhängig von der Plasmakonzentration U-förmig. Im hochnormalen Bereich zwischen 4,5 und 5 mmol/l ist das Risiko für Herzrhythmusstörungen am geringsten. Genau dieser Zielbereich wurde in der randomisierten und placebokontrollierten POTCAST-Studie angestrebt, um zu zeigen, ob Patienten, bei denen wegen einer Herzerkrankung ein Kardioverter-Defibrillator (ICD) implantiert wurde, von der Behandlung profitieren. Der kombinierte primäre Endpunkt setzte sich zusammen aus ICD-Therapie, dem Auftreten von nachhaltigen ventrikulären Arrhythmien, aus ungeplanter Arrhythmie- oder Herzinsuffizienz-bedingter Krankenhauseinweisung sowie aus Tod jeglicher Genese. Insgesamt 1200 ICD-Patienten mit einem Serumkalium von ≤4,3 mmol/l und erhaltener Nierenfunktion wurden im Verhältnis 1 : 1 randomisiert in eine Gruppe mit hochtitriertem Serumkalium und Standardtherapie und in eine Gruppe mit Placebo und Standardtherapie. Der Follow-up-Zeitraum betrug 39 Monate. Alle sechs Monate erfolgten Zwischenuntersuchungen mit ICD-Auslesung, EKG-Untersuchung, Blutuntersuchung und Medikationskontrolle. Die Anhebung der Serumkaliumkonzentration erfolgte durch eine kaliumreiche Ernährung, durch Zufuhr von Kalium-supplementen, durch einen bevorzugten Einsatz von kaliumsparenden Diuretika und durch Dosisreduktion bei Diuretika mit Kaliumverlust. Durch die Anhebung des Serumkaliums auf hochnormale Werte konnte die Rate an im primären Endpunkt festgelegten Ereignissen um 24 % reduziert werden. Die Therapie wurde gut vertragen. Die Rate an Klinikeinweisungen wegen einer Hypo- oder Hyperkaliämie war in beiden Gruppen vergleichbar. Damit steht eine kostengünstige, im Alltag leicht umsetzbare und wirksame Therapie zur Behandlung von Patienten mit einem hohen Risiko von Herzrhythmusstörungen und niedrigen Serumkaliumwerten (≤4,3 mmol/l) zur Verfügung.
Leitlinien-Update Hypercholesterinämie
Bei der Definition der vom kardiovaskulären Risiko abhängigen Therapieziele wurden kleinere Ergänzungen eingebracht. Das kardiovaskuläre Risiko für ein Ereignis in den nächsten zehn Lebensjahren wird mit der Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE2) und der SCORE2-OP (OP: „older persons”) abgeschätzt. Außerdem wurde eine weitere Gruppe mit extremem Risiko aufgenommen mit einem LDL-C-Therapieziel <1 mmol/l (<40 mg/dl). Dieser Gruppe werden Patienten mit atherosklerotischen Gefäßerkrankungen zugeordnet, die trotz einer maximal verträglichen Statintherapie nochmalige kardiovaskuläre Ereignisse hatten oder bei denen eine polyvaskuläre arterielle Erkrankung vorliegt. Zusätzlich zur Risikoabschätzung durch SCORE2 und SCORE2-OP wurde eine Reihe von Parametern definiert, die die zukünftige Risikoentwicklung beeinflussen („risk modifiers”). Dazu gehören neben Familienanamnese und ethnischer Zugehörigkeit auch Stress, Adipositas, körperliche Inaktivität, chronisch entzündliche Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen oder obstruktive Schlafpnoe. Interessant sind die beiden als „risk modifiers” aufgeführten Biomarker eines dauerhaft erhöhten hochsensitiven C-reaktiven Proteins (hsCRP) >2 mg/l und eines erhöhten Lipoprotein(a) (LP(a)) >50 mg/dl (>105 nmol/l). Bei den Therapieempfehlungen für Patienten mit einer Hypercholesterinämie, die nicht für eine Statintherapie geeignet sind, sollen mit einem IA-Evidenzlevel andere Medikamente mit nachgewiesenem kardiovaskulären Nutzen eingesetzt werden, um das kardiovaskuläre Risiko zu senken. Die Auswahl dieser Medikamente soll dabei ausschließlich auf dem Ausmaß der damit erreichbaren additiven LDL-C-Senkung (Low-density Lipoprotein – Cholesterin) basieren. Zum Thema diätetische Supplemente zur Behandlung der Hypercholesterinämie wurde basierend auf der vorhandenen Evidenz in der Leitlinie eine neue Empfehlung aufgenommen, die den Einsatz von Supplementen oder Vitaminen ohne dokumentierte Anwendungssicherheit und ohne den Nachweis einer wirksamen LDL-C-Senkung ablehnt. Bei Patienten mit einem akuten Koronarsyndrom (ACS), vor allem bei denen mit einem erneuten Ereignis, empfehlen die Leitlinien eine frühzeitige Eskalation der LDL-C-senkenden Therapie, die über den alleinigen Einsatz von Statinen hinausgeht. Wenn absehbar ist, dass der Patient das Therapieziel mit einem Statin nicht erreicht, sollte sofort mit einer Kombinationstherapie begonnen werden.
VICTORION-Difference-Studie: Mit Inclisiran-basierter Therapie Zielwerte schneller erreichen
In dieser Studie sollten die Wirksamkeit, Anwendungssicherheit und der Einfluss auf die Lebensqualität von Inclisiran im Vergleich zu Placebo im Rahmen einer individuell optimierten lipidsenkenden Therapie bei Patienten mit einer Hypercholesterinämie untersucht werden, die nicht ihre in den Leitlinien empfohlenen Zielwerte erreicht haben. Das Studiendesign sollte sicherstellen, dass alle Patienten die Studie mit einer stabilen Statindosis beginnen, die in der Run-in-Phase und während der doppelblinden Behandlungsphase optimiert wird. Die Patienten erhielten eine Dosiseskalation, bis sie entweder ihr individuelles LDL-C-Ziel oder die maximal verträgliche Dosis erreichten. Insgesamt 1776 Patienten wurden im Verhältnis 1 : 1 entweder mit einer Inclisiran-basierten Behandlungsstrategie (300 mg Inclisiran subkutan plus Rosuvastatin) oder einer individuell optimierten lipidsenkenden Therapie (Placebo subkutan plus Rosuvastatin) behandelt. In beiden Behandlungsarmen wurde die Therapie individuell optimiert. Die meisten Patienten waren männlich und hatten ein sehr hohes kardiovaskuläres Risiko mit einer mittleren Baseline-LDL-C-Konzentration von 90,9 mg/dl. Das mittlere Alter betrug 63,7 Jahre. Die Baseline-Charakteristika in beiden Behandlungsgruppen waren ausgeglichen. Als primärer Endpunkt war die Erreichung des LDL-C-Zielwertes an Tag 90 festgelegt. Dieser Endpunkt wurde mit der Inclisiran-basierten Therapie bei 84,9 % der Patienten erreicht im Vergleich zu 31 % in der Kontrollgruppe. Muskelassoziierte Nebenwirkungen waren als einer der sekundären Endpunkte definiert. Bei der Inclisiran-basierten Therapie wurden sie bei 11,9 % der Patienten dokumentiert im Vergleich zu 19,2 % in der Kontrollgruppe. Muskelschmerzen und Myopathien sind nach wie vor ein relevantes Problem der Statintherapie.
MAPLE-HCM und ODYSSEY-HCM bei hypertropher Kardiomyopathie mit und ohne Obstruktion
Nicht vasodilatierende Betablocker sind bei Patienten mit einer symptomatischen obstruktiven hypertrophen Kardiomyopathie (oHCM) seit 60 Jahren die Therapie der ersten Wahl, um die Sauerstoffversorgung und die Lebensqualität zu verbessern. Diese Empfehlung basiert aber nicht auf kontrollierten Endpunktstudien, sondern nur auf klinischen Untersuchungen mit kleinen Patientenzahlen. Eine Reduktion des pathologisch erhöhten Obstruktionsgradienten der Ausstrombahn (LVOT-Gradient) im linken Ventrikel durch einen Betablocker, wie zum Beispiel Metoprolol, wurde bislang nicht nachgewiesen. Mavacamten ist der erste Vertreter der neuen Wirkstoffklasse der Myosin-Inhibitoren, deren Wirksamkeit bei Patienten mit einer oHCM mit kontrollierten Endpunktstudien dokumentiert wurde. Die Patienten mit einer oHCM leiden unter belastungsabhängiger Luftnot oder Brustschmerzen. Der beste primäre Endpunkt mit der höchsten Sensitivität in den klinischen Studien ist deshalb die maximale Sauerstoffsättigung (pVO2) im arteriellen Blut. Aficamten ist ein neuer Myosin-Inhibitor, dessen Wirksamkeit in der MAPLE-HCM-Studie erstmals im direkten Vergleich zu Metoprolol untersucht wurde. Primärer Endpunkt war die pVO2, als sekundäre Endpunkte waren NYHA-Klasse, Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire – Clinical Summary Score (KCCQ-CSS), Valsalva-LVOT-Gradient, NT-proBNP sowie strukturelle und funktionale Echokardiografieparameter. Nach einer zweiwöchigen Wash-out-Phase wurden die Baseline-Parameter dokumentiert. Danach erfolgte eine Randomisierung im Verhältnis 1 : 1 in eine Gruppe (n = 88) mit Aficamten und Placebo und in eine Gruppe (n = 87), die mit Metoprolol und Placebo behandelt wurde. Die Behandlungsdauer betrug 24 Wochen, wobei in den ersten sechs Wochen die Auftitration unter echokardiografischer Kontrolle bis zur maximal verträglichen Dosis erfolgte. 62 % der Patienten erreichten hohe Metoprolol-Dosierungen von 150 oder 200 mg/Tag. 76 % wurden mit 15 oder 20 mg Aficamten behandelt. Unter einer Therapie mit Aficamten stieg die maximale Sauerstoffaufnahme deutlich an, während sie unter der Betablockade abfiel. Der „last square mean”-(LSM-)Unterschied mit Standardabweichung zwischen beiden Behandlungsgruppen betrug 2,3 (0,39) ml/kg/min (p < 0.0001). Die Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen bei allen anderen sekundären Endpunkten waren ebenfalls signifikant zugunsten von Aficamten mit Ausnahme der Veränderung im linksventrikulären Massenindex (LVMI) (p = 0.163). Die NT-proBNP-Konzentration stieg während der 24 Wochen unter Metoprolol leicht an, während sie unter Aficamten deutlich (–81%) abfiel. Die Ergebnisse der MAPLE-HCM-Studie werden sehr wahrscheinlich den Empfehlungsgrad für den Einsatz von Betablockern bei der oHCM beeinflussen. In der ODYSSEY-HCM-Studie wurde Mavacamten bei Patienten mit einer symptomatischen nicht obstruktiven hypertrophen Kardiomyopathie (noHCM) untersucht. In diese klinisch sehr relevante Studie wurden symptomatische Patienten (NYHA II–III) mit einer in Referenzzentren gesicherten HCM ohne LVOT-Gradienten (Peak LVOT <30 mmHg in Ruhe und <50 mmHg nach Provokation), einer links-ventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) von ≥60 % und einem erhöhten NT-proBNP (≥200 pg/ml) eingeschlossen. Patienten mit anderen Erkrankungen, die mit einer linksventrikulären Wandverdickung assoziiert sind, oder Aneurysmen wurden ausgeschlossen. 580 Patienten wurden im Verhältnis 1 : 1 entweder mit Mavacamten oder Placebo behandelt. Mavacamten wurde auf die Dosis von bis zu 10 oder 15 mg auftitriert. Die Behandlungszeit betrug 48 Wochen. Es konnte bei keinem Parameter ein Unterschied zwischen beiden Behandlungsgruppen dokumentiert werden, was zu einer kontroversen Diskussion und neuen Studienansätzen zum Einsatz einer Myosin-Inhibition bei symptomatischen Patienten mit einer nicht obstruktiven HCM führen wird.
Leitlinien-Update Herzklappenerkrankungen
In der ESC-Leitlinie zu Herzklappenerkrankungen aus dem Jahr 2021 wurden im aktuellen Update einige Schwerpunkte neu gesetzt und Empfehlungen aufgrund neuer Studienergebnisse überarbeitet. Zum Beispiel wird bei Patienten mit einem leichten oder moderaten Risiko für eine obstruktive koronare Herzerkrankung vor einer Klappenintervention eine koronare Computertomografie-Angiografie (CCTA) empfohlen (Klasse IIa, Level C), statt eine klassische Koronarangiografie durchzuführen. Allerdings wird bei der Umsetzung dieser Empfehlung in der klinischen Praxis die Vergütungsfrage noch eine Rolle spielen. Eine zweite wichtige Änderung betrifft die Intervention bei einer Aortenstenose. Eine Transkatheter-Aortenklappenintervention (TAVI) wurde in der Leitlinie von 2021 erst bei Patienten >75 Jahre mit einem hohen Risiko empfohlen, die für einen chirurgischen Klappenersatz nicht geeignet sind. Die 2025er-Leitlinie empfiehlt eine TAVI bereits ≥70 Jahre, wenn die Patienten eine trikuspide Klappenstenose haben und die Anatomie geeignete Voraussetzungen bietet. Ein Risikoscore ist für die Intervention nicht mehr vorgegeben (Klasse I, Level A).
Leitlinie zur Myokarditis und Perikarditis
Diese unter deutscher Federführung erarbeitete Leitlinie wurde erstmals vorgestellt. Zusätzlich zur Perikarditis und Myokarditis wurde mit dem Begriff des inflammatorischen myoperikardialen Syndroms (IMPS) eine neue Bezeichnung eingeführt. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass es zwischen einer Perikarditis und einer Myokarditis Überlappungen gibt, bei der beide Gewebetypen auf den entzündlichen Prozess reagieren. Im Rahmen der Diagnostik werden neben der Echokardiografie eine kardiovaskuläre Magnetresonanztomografie (CMR) mit entsprechenden Kontrastdarstellungen sowie, falls Zweifel bestehen, eine histologische Befundsicherung durch Entnahme einer endomyokardialen Biopsie (EMB) empfohlen. Beim klinischen Diagnosealgorithmus hat sich somit im Laufe der letzten zwölf Jahre ein Paradigmenwechsel vollzogen. Zur Therapie von Patienten mit einer akuten Perikarditis werden neben einer Bewegungsrestriktion nicht steroidale Antiphlogistika (NSAR) und Colchizin empfohlen (Klasse I). Wenn die Patienten nach drei bis sechs Monaten auf die Therapie ansprechen, können NSAR und Colchizin reduziert werden. Sollte immer noch eine aktive IMPS bestehen, können zusätzlich Kortikosteroide eingesetzt werden (Klasse IIa). Als neu aufgenommene letzte Option im Algorithmus empfiehlt die Leitlinie den Einsatz einer gegen Interleukin-1 gerichtete Therapie mit Anakinra oder Rilonacept (Klasse I).
BEAT-AF-Studie: PFA oder RF zur Ablationstherapie bei Vorhofflimmern?
Zur Ablationstherapie bei Patienten mit Vorhofflimmern mit und ohne Herzinsuffizienz kommt neben der seit Jahrzehnten bewährten Radiofrequenzablation (RF) auch die Pulsed-Field-Ablation (PFA) zum Einsatz. Beide Verfahren wurden jetzt in einer europäischen Multicenterstudie mit 292 Patienten verglichen, die an einem gegenüber Medikamenten resistenten Vorhofflimmern erkrankt waren. In beiden Behandlungsarmen war die Erfolgsrate ein Jahr nach der Intervention mit etwa 77 % gleich hoch, und beide Verfahren hatten ein gutes Sicherheitsprofil. Die PFA hat den Vorteil, dass die Intervention schneller durchgeführt werden kann.
ALONE-AF-Studie: Kann die Antikoagulation ein Jahr nach der Ablation beendet werden?
Eine weitere wichtige Studie untersuchte die Fragestellung, ob bei Patienten mit Vorhofflimmern, bei denen innerhalb eines Jahres nach erfolgreicher Ablation kein Vorhofflimmern (VHF) mehr detektiert werden konnte, eine weitere Antikoagulation notwendig ist. Dazu wurde bei 840 Patienten ohne VHF-Rezidiv nach zwölf Monaten mit einem mittleren CHA2DS2-VASc-Score von 2 (Range 1–3) randomisiert im Verhältnis 1 : 1 entweder die Antikoagulation weitergeführt oder beendet. Primärer kombinierter Endpunkt war das Auftreten eines Schlaganfalles, einer systemischen Embolie oder einer größeren Blutung. Nach einer Beobachtungszeit von zwei Jahren wurde die Studie ausgewertet. Die Ereignisrate bei den Patienten ohne weitere Antikoagulation war mit einem absoluten Unterschied von 1,9 Prozentpunkten niedriger als bei den antikoagulierten Patienten. Eine Antikoagulation kann bei Patienten mit Vorhofflimmern also ein Jahr nach einer erfolgreichen Ablation beendet werden, wenn die Patienten kein Rezidiv hatten.
Fazit
- HFrEF-Patienten mit stabiler Pumpfunktion ohne HFH seit sechs oder ohne i. v. Diuretikatherapie seit drei Monaten profitierten in der VICTOR-Studie nicht von einer Therapie mit Vericiguat zusätzlich zur leitliniengemäßen Basistherapie.
- In der gepoolten Analyse von VICTOR- und VICTORIA-Studie verbesserte Vericiguat im Vergleich zu Placebo die klinischen Ergebnisse bezüglich des primären kombinierten Endpunktes aus kardiovaskulär bedingtem Tod oder erster HFH über das gesamte Risikospektrum von Patienten mit HFrEF.
- Die Ergebnisse der DIGIT-HF-Studie haben gezeigt, das Digitoxin das primäre Outcome von Patienten mit einer symptomatischen HFrEF zusätzlich zur leitliniengemäßen Basistherapie verbessert.
- In der POTCAST-Studie verbesserte die Anhebung der Serumkaliumwerte auf hochnormale Werte bei ICD-Patienten den primären kombinierten Endpunkt aus ICD-Therapie, Arrhythmierate, ungeplante Arrhythmie- oder Herzinsuffizienz-bedingter Hospitalisierung sowie Tod jeglicher Genese.
- Die VICTORION-Difference-Studie zeigte, dass mit einer Kombination von Inclisiran und Rosuvastatin deutlich mehr Patienten mit einer Hypercholesterinämie ihr LDL-C-Ziel erreichen als mit einer Rosuvastatintherapie.
- Zur Therapie von HCM-Patienten wurden zwei Studien vorgestellt: In der MAPLE-HCM-Studie verbesserte der Myosin-Inhibitor Aficamten im Vergleich zu Metoprolol das Outcome von Patienten mit einer symptomatischen obstruktiven hypertrophen Kardiomyopathie (oHCM). Bei symptomatischen HCM-Patienten ohne Obstruktion konnte mit Mavacamten im Vergleich zu Placebo in der ODYSSEY-HCM-Studie keine Outcomeverbesserungen erreicht werden.
- Die ESC-Therapieleitlinien zur Hypercholesterinämie und zu Herzklappenerkrankungen wurden überarbeitet. Erstmals wurde eine Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Perikarditis und Myokarditis vorgestellt
- Die BEAT-HF-Studie hat gezeigt, dass eine Pulsed-Field-Ablation zur Behandlung von Patienten mit einem therapieresistenten Vorhofflimmern genauso wirksam und sicher ist wie das bewährte Radiofrequenzverfahren. Bei VHF-Patienten, die ein Jahr lang nach einer Ablation rezidivfrei sind, kann aufgrund der Daten der ALONE-HF-Studie eine Antikoagulation abgesetzt werden
Bildnachweis
ipopba – stock.adobe.com